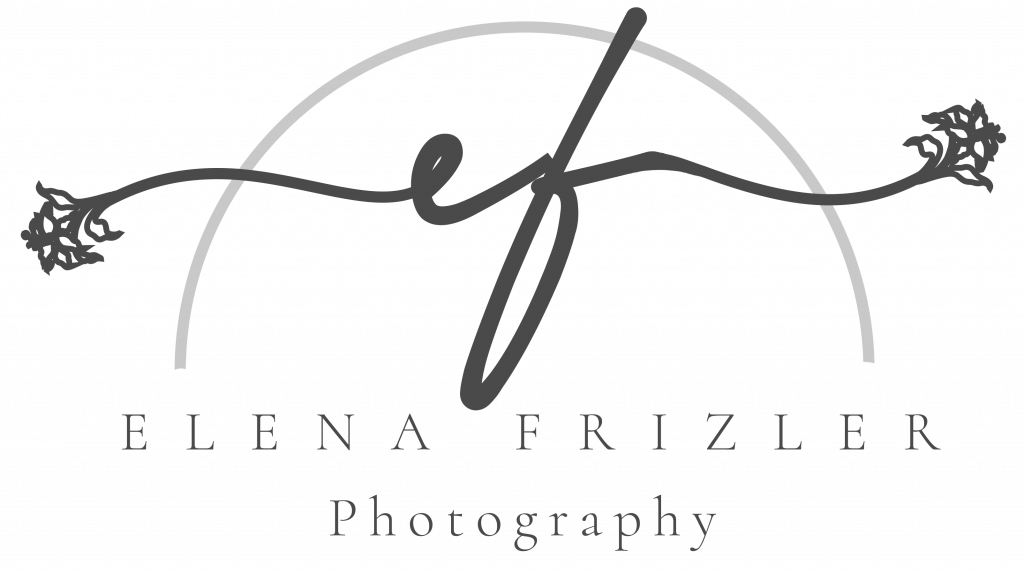Wie wir eine überdimensionale Muschel gebaut haben.
Ein Herzensprojekt – 3 Jahre geträumt,
3 Wochen gebaut.
Teil 1 - Die Herstellung der Muschel.
Es gibt Ideen, die begleiten einen viele Jahre. Sie flackern immer wieder auf, kommen zurück in stillen Momenten, werden weitergesponnen – und landen doch jedes Mal wieder in der Schublade „zu kompliziert“.
Unsere Muschel war genau so eine Idee.
Die Inspiration – und warum sie lange nur ein Traum blieb
Schon vor drei Jahren war da dieses Bild im Kopf: eine riesige, strahlend weiße Muschel. Geöffnet wie eine Venusmuschel, in der eine Figur ruht – märchenhaft, anmutig, wie aus einer anderen Welt. Eine Kulisse für Fantasy- oder Meerjungfrauen-Shootings. Eine Art Thron aus dem Ozean.
Aber wie soll man so etwas bauen?
Wir hatten so viele Ideen. Fiberglas, Pappmaché, Holz, sogar aufgeblasene Kunststoffformen standen zur Diskussion. Manche Konzepte waren technisch kaum machbar, andere zu schwer, zu teuer oder schlicht unpraktisch für den Transport. Und so vergingen die Jahre, immer wieder mit Phasen voller Notizen, Skizzen, vergeblicher Recherchen – bis wir beschlossen: Nicht mehr zu kompliziert denken.
Die Lösung: Styropor. Einfach, leicht – und erstaunlich vielseitig.
Als wir schließlich auf die Idee kamen, die Muschel aus Styropor zu bauen, fühlte es sich fast lächerlich simpel an. Warum sind wir da nicht früher draufgekommen? Vielleicht, weil wir den Wald vor lauter Bäumen nicht sahen. Oder weil wir bei all den groß gedachten Möglichkeiten das Naheliegende übersehen hatten.
Wir kauften dicke Styroporplatten mit 10 cm Stärke – leicht, formbar, groß genug. Vorher hatten wir natürlich exakt ausgerechnet, wie viele Quadratmeter wir brauchen würden und welche Maße die Muschel letztlich haben sollte. Wichtig war: Die fertige Muschel sollte groß und eindrucksvoll sein, aber dennoch transportabel bleiben. Also musste sie in einzelne Segmente zerlegbar sein. Die größte Herausforderung dabei war das Verhältnis zwischen Größe und Mobilität. Denn: So ein Teil passt in keinem Auto der Welt, wenn es am Stück bleibt.
Schritt für Schritt zur Form – das Schneiden, Schleifen, Säubern.
Zuerst wurden die einzelnen „Mantelstücke“ der Muschel grob zugeschnitten – oben breiter, unten schmaler, sodass sie im Halbkreis zusammenlaufen. Insgesamt entstanden so 13 Elemente für den Deckel und 13 für den Boden. Diese sollten später eine harmonisch gerundete, muschelartige Form ergeben.
Wir begannen mit der eigentlichen Formgebung. Mit Cutter, Sägen und Stahlbürsten formten wir jede Platte: rund, leicht gewölbt und mit einer dezenten Aushöhlung, damit die spätere Muschelform nicht flach, sondern lebendig wirkt. Und ja – Styropor ist wirklich angenehm zu bearbeiten. Man sieht sofort Ergebnisse, Formen entstehen schnell.
Aber die Sauerei ist… unbeschreiblich. Wer einmal mit Styropor gearbeitet hat, weiß: Diese kleinen Kügelchen finden ihren Weg überall hin. Ich glaube, wir haben mindestens genauso viel Zeit mit Fegen und Saugen verbracht wie mit der eigentlichen Arbeit.
Puzzle auf dem Boden – und die Entscheidung für das Klebesystem.
Als alle Teile geformt waren, haben wir sie ausgelegt wie ein riesiges Puzzle. So konnten wir prüfen, welche Stücke am besten zueinander passen, kleinere Makel nach unten ausrichten und sicherstellen, dass die schöne Seite sichtbar bleibt. Anschließend wurde jedes Teil beschriftet, damit beim späteren Zusammenbau nichts verwechselt wird.
Beim Zusammenkleben der Segmente standen wir wieder vor einem logistischen Problem: 13 Teile pro Muschelhälfte – wie viele davon können wir fest miteinander verkleben, ohne dass das Segment zu groß zum Transport wird?
Unsere erste Idee: einfach halbieren – also zwei große Hälften mit je 6 bzw. 7 Teilen. Aber auch das war zu unhandlich. Und zu riskant. Denn so viele geklebte Stirnflächen in einem Segment erhöhen die Bruchgefahr.
Die Lösung war eine 5–3–5-Aufteilung. Also: drei Segmente pro Muschelhälfte. Diese konnten wir noch gut transportieren, und sie waren stabil genug, um später wieder zu einer ganzen Schale zusammengesetzt zu werden.
Kleben mit Gefühl – und Geduld.
Beim Kleben setzten wir ausschließlich speziellen Styroporkleber auf Wasserbasis ein. Ein Fehler mit lösungsmittelhaltigem Kleber – und man sieht dem Styropor beim Schmelzen zu. Die Klebeflächen wurden satt mit Spachtel bestrichen, die Teile zusammengesetzt und dann mit Gummibändern und Zurrgurten in Form gehalten. Nicht zu stark – zu viel Druck hätte das Material verformt oder zerdrückt.
Nach dem Trocknen (mindestens drei Tage) prüften wir die Verbindungen. Stabil, fest – aber an manchen Stellen waren Rillen entstanden, oder der Kleber war leicht eingesackt. Also nochmal nachgearbeitet: Rillen erneut mit Kleber gefüllt, glattgestrichen, wieder gewartet. Wir wollten keine halben Sachen machen.
Unsichtbare Technik: die versteckten Gewindeverbindungen.
Nun brauchten wir eine Möglichkeit, die drei Segmente jeder Muschelhälfte stabil miteinander zu verbinden – und zwar so, dass man die Verbindung später nicht sieht. Schrauben in Styropor? Keine gute Idee.
Unsere Lösung: kleine Holzklötze mit eingesetzten Gewindestiften. Diese wurden in das Styropor eingelassen und mit Spezialkleber fixiert. Die Verbindungsleisten aus Holz wurden daraufhin mit passenden Löchern versehen und später mit Muttern verschraubt. So entstand ein solides Stecksystem, mit dem wir die Muschel vor Ort rasch aufbauen können.
Schleifen, Versiegeln, Grundieren – das Finish beginnt.
Bevor wir Farbe ins Spiel bringen konnten, mussten alle Oberflächen geschliffen werden – und zwar mit mehreren Körnungen, um die Struktur der Styroporkügelchen zu glätten. Zwar wollten wir auf Spachtelmasse für die ganze Fläche verzichten (die Muschel sah auch so sehr natürlich und organisch aus), aber an den Fugen kam sie zum Einsatz – fein modelliert, glattgezogen, dezent kaschiert.
Dann wurde grundiert: mit Acryl-Tiefengrund auf Wasserbasis – zwei Schichten, mit Trocknungszeit dazwischen. Diese Versiegelung verhindert, dass das Styropor später die Farbe wie ein Schwamm aufsaugt und schützt es zusätzlich vor Feuchtigkeit.
Der Anstrich – fast wie Perlmutt.
Für die Farbe entschieden wir uns für einen eleganten Perlmutt-Ton. Fast weiß, aber mit einem Hauch Creme – nicht gelblich, sondern edel und fein. Eine Farbe, die schimmert, ohne zu glänzen, und dem ganzen Objekt etwas Zeitloses verleiht. Auch hier: Zwei Schichten, je ein Tag Trockenzeit. Parallel wurden auch die Leisten in der gleichen Farbe bemalt, damit sie nicht nur funktional sind, sondern sich harmonisch ins Gesamtbild einfügen.
Der Dreizack
Neben der Muschel entstand parallel auch ein klassischer Dreizack als Requisite. Die Basis war eine schlichte Holzkonstruktion, die wir sorgfältig zurechtgesägt und zusammengesetzt haben. Anschließend wurde er mit metallic-goldenem Spray lackiert, wodurch er einen edlen Glanz erhielt. Zum Schluss kamen noch kleine, dezente Muschelapplikationen hinzu, die dem Dreizack den letzten Schliff gaben und ihn perfekt in das maritime Setting einfügen.
Das Ergebnis – eine Requisite, auf die wir stolz sind
Nach unzähligen Stunden, etlichen Putzaktionen, vielen Entscheidungen und viel Freude an der Umsetzung war sie endlich fertig: unsere Muschel.
Leicht, aber stabil. Zerlegbar, aber eindrucksvoll. Und ein echter Hingucker für märchenhafte Fantasyshootings.
Natürlich gab es noch viele kleine Herausforderungen zwischendurch, die ich hier gar nicht alle erwähnen kann – aber sie gehören zum Prozess. Und was am Ende zählt: Wir haben eine Muschel gebaut, die vorher nur in unseren Köpfen existierte.
Das war der erste Teil des Muschel-Blogs – vom Konzept über die Planung bis hin zur fertigen Konstruktion. Im zweiten Teil nehm ich euch mit hinter die Kulissen des Transports, zeigen die Herausforderungen beim Aufbau vor Ort und begleiten das Fotoshooting selbst am Wasserfall. Sei gespannt auf den nächsten Schritt dieser kreativen Reise!
Sharing is caring

Elena Frizler
Fotografin, Künstlerin, Schneiderin, Bastlerin, Träumerin, Abenteurerin